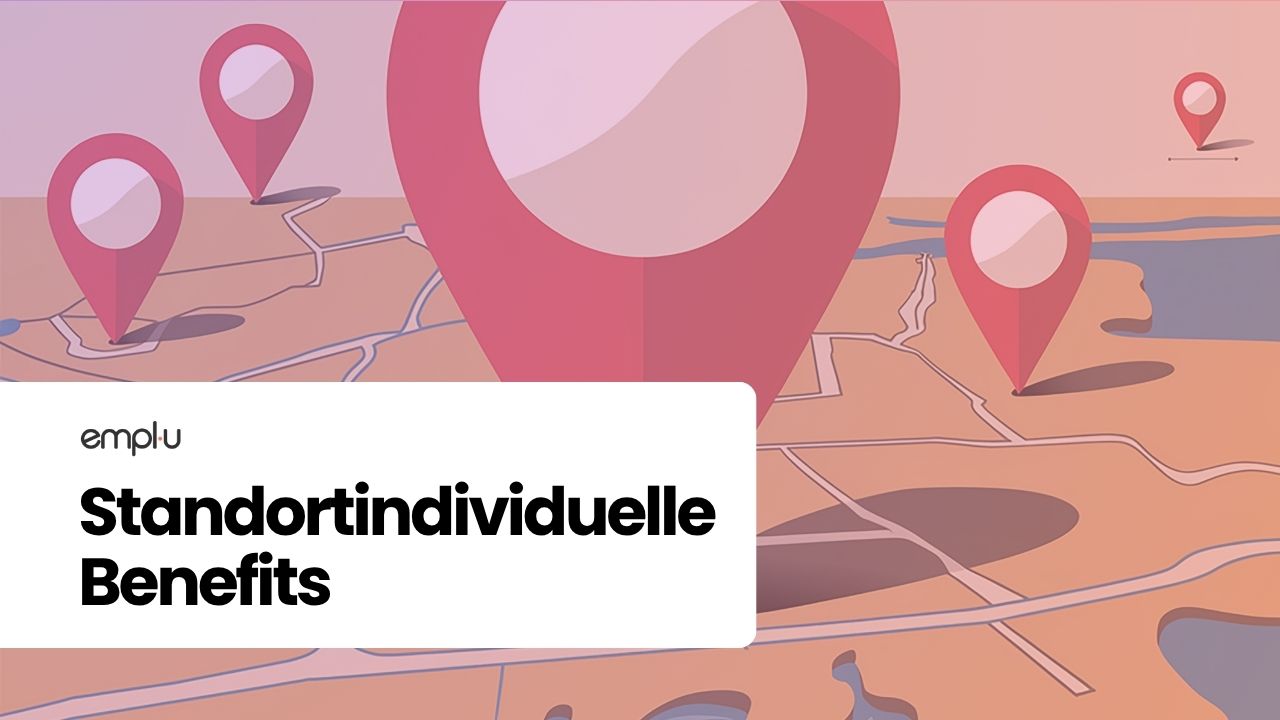Leonard Gohlke
18. November 2025

Fitnessstudio-Mitgliedschaft für alle. Obstkorb im Büro. Yoga-Kurs am Donnerstag. Klingt nach moderner Gesundheitsförderung? Tatsächlich nutzen diese klassischen Benefits oft weniger als 20% der Belegschaft aktiv.
Der Grund ist einfach, Menschen sind unterschiedlich. Was der einen Mitarbeiterin bei Stress hilft, interessiert den anderen überhaupt nicht. Während Lisa nach der Arbeit zum Joggen geht, braucht Michael eher eine Therapiesitzung. Und Sarah würde am liebsten einfach früher Feierabend machen, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.
Die Lösung? Wellbeing-Budgets – flexible Gesundheitsbudgets, die Mitarbeitende selbst verwalten und für die Benefits einsetzen können, die ihnen wirklich helfen.
In diesem Artikel zeigen wir, warum Wellbeing-Budgets der Standard für 2025 werden, welche Unternehmen bereits erfolgreich darauf setzen und wie Sie ein solches Programm implementieren.
Ein Wellbeing-Budget ist ein individuelles Gesundheitsbudget, das Unternehmen ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Anders als bei klassischen Benefits-Programmen mit vordefinierten Angeboten haben Mitarbeitende hier die freie Wahl, wofür sie das Budget einsetzen möchten. Die Höhe variiert dabei je nach Unternehmensgröße und Branche. Startups und kleine bis mittelständische Unternehmen stellen ihren Mitarbeitenden typischerweise zwischen 300 und 600 Euro pro Jahr zur Verfügung, während mittelgroße Unternehmen oft mit 600 bis 1.200 Euro kalkulieren. Konzerne und Tech-Unternehmen gehen häufig noch einen Schritt weiter und bieten zwischen 1.200 und 2.400 Euro jährlich an.
Die Einsatzmöglichkeiten für solche Wellbeing-Budgets sind vielfältig und decken nahezu alle Bereiche ab, die das Wohlbefinden von Mitarbeitenden beeinflussen. Im Bereich der mentalen Gesundheit können die Budgets beispielsweise für Therapiesitzungen und psychologische Beratung genutzt werden, aber auch für Coaching, Mentoring-Programme oder den Zugang zu Meditations-Apps wie 7Mind. Stressmanagement-Kurse fallen ebenfalls in diese Kategorie.
Für die körperliche Gesundheit stehen Mitarbeitenden Optionen wie Fitnessstudio-Mitgliedschaften, Sportvereine oder Kurse für Yoga, Pilates und Schwimmen zur Verfügung. Auch Physiotherapie, Massagen und ergonomische Home-Office-Ausstattung können aus dem Budget finanziert werden. Der Bereich Work-Life-Balance umfasst Unterstützung bei der Kinderbetreuung, Babysitting-Dienste, Haushaltshilfen, Meal-Prep-Services oder sogar die Möglichkeit, zusätzliche Urlaubstage zu kaufen.
Weiterbildung und persönliche Entwicklung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Mitarbeitende können das Budget für Online-Kurse, Workshops, Fachbücher, Hörbücher, Konferenz-Tickets oder Sprachkurse verwenden. Auch das soziale Wohlbefinden wird berücksichtigt, etwa durch die Finanzierung von Team-Events, ehrenamtlichen Projekten oder Networking-Veranstaltungen.
Die Wirksamkeit von Wellbeing-Budgets lässt sich durch mehrere wissenschaftliche Erkenntnisse erklären. Die psychologische Forschung zur Selbstbestimmungstheorie zeigt deutlich, dass Menschen motivierter und zufriedener sind, wenn sie Autonomie über Entscheidungen haben, die sie direkt betreffen. Wellbeing-Budgets geben genau diese Autonomie und ermöglichen es Mitarbeitenden, selbst zu entscheiden, welche Form der Unterstützung ihnen am meisten hilft. Eine Untersuchung der Universität Zürich aus dem Jahr 2024 belegt diese Theorie eindrucksvoll: Die Nutzungsrate von Gesundheitsangeboten steigt um beachtliche 340 Prozent, wenn Mitarbeitende selbst wählen können, statt vorgegebene Programme nutzen zu müssen.
Das Problem mit klassischen Einheitslösungen wird durch aktuelle Zahlen deutlich. Nur 18 bis 25 Prozent der Mitarbeitenden nutzen Corporate Benefits aktiv, während sich 67 Prozent von Standard-Angeboten nicht angesprochen fühlen. Der Return on Investment von traditionellen Wellbeing-Programmen bleibt daher oft weit unter den Erwartungen. Wellbeing-Budgets hingegen zeigen eine völlig andere Dynamik. Die Nutzungsrate liegt konstant zwischen 75 und 85 Prozent, die durchschnittliche Zufriedenheit erreicht 4,2 von 5 Sternen, und der wahrgenommene Wert ist dreimal höher als bei fixen Benefits-Programmen.
Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Tatsache, dass verschiedene Lebensphasen unterschiedliche Unterstützung erfordern. Betrachten wir die Lebensrealitäten in einem typischen Team:
Sarah ist 32 Jahre alt, hat zwei kleine Kinder und benötigt dringend Unterstützung bei der Kinderbetreuung.
Michael ist 45 und leidet unter chronischen Rückenschmerzen, weshalb regelmäßige Physiotherapie für ihn essentiell ist.
Lisa hingegen ist 27, Single und möchte vor allem in ihre Fitness und persönliche Entwicklung investieren.
Thomas schließlich ist 56 Jahre alt und kümmert sich um seine pflegebedürftigen Eltern, was ganz andere Formen der Unterstützung erfordert.
Eine einheitliche Firmenfitness-Mitgliedschaft würde in diesem Szenario lediglich Lisa helfen, während die anderen drei leer ausgehen. Ein flexibles Budget hingegen ermöglicht es jedem einzelnen, die Unterstützung zu erhalten, die er oder sie wirklich braucht.
Die finanziellen Auswirkungen von Wellbeing-Budgets lassen sich konkret messen und beziffern. Unternehmen, die solche Programme einführen, verzeichnen durchschnittlich 23 Prozent weniger Krankenstandstage. Dies basiert auf Daten aus dem DAK Gesundheitsreport 2024. Gleichzeitig sinkt die Fluktuation bei Unternehmen mit flexiblen Wellbeing-Angeboten um beachtliche 35 Prozent. Die Gallup Wellbeing-Studie 2024 belegt zudem eine Produktivitätssteigerung von durchschnittlich 18 Prozent.
Um diese Zahlen greifbarer zu machen, lohnt sich ein Blick auf ein konkretes Rechenbeispiel für ein mittelgroßes Unternehmen mit 100 Mitarbeitenden. Die Investition in ein Wellbeing-Budget liegt bei 600 Euro pro Mitarbeiter und Jahr, was insgesamt 60.000 Euro entspricht. Hinzu kommen etwa 6.000 Euro für die Verwaltung über eine Plattform, sodass sich die Gesamtinvestition auf 66.000 Euro beläuft.
Die Einsparungen fallen deutlich höher aus. Wenn die durchschnittlichen Krankheitstage von 15 auf 12 Tage pro Jahr sinken, ergeben sich bei 100 Mitarbeitenden und durchschnittlichen Kosten von 400 Euro pro Krankheitstag Einsparungen von 120.000 Euro. Die Reduzierung der Fluktuation von 15 auf 10 Prozent bedeutet fünf Neueinstellungen weniger pro Jahr. Bei durchschnittlichen Rekrutierungskosten von 15.000 Euro pro Position entspricht dies einer Ersparnis von 75.000 Euro. Die Produktivitätssteigerung lässt sich schwerer beziffern, kann aber konservativ mit etwa 50.000 Euro angesetzt werden.
Zusammengerechnet ergeben sich Gesamteinsparungen von 245.000 Euro, was einem Return on Investment von 272 Prozent entspricht. Anders ausgedrückt: Jeder investierte Euro bringt 2,72 Euro zurück. Diese Rechnung berücksichtigt noch nicht die schwerer messbaren, aber dennoch wertvollen Effekte auf das Employer Branding und die Mitarbeiterzufriedenheit.
Im Bereich Employer Branding zeigen sich ebenfalls messbare Vorteile. Laut aktuellen Studien bewerten 78 Prozent der Bewerber Wellbeing-Benefits als wichtiges Entscheidungskriterium bei der Arbeitgeberwahl. Flexible Benefits erhöhen die Arbeitgeberattraktivität signifikant, was sich auch in den Bewertungen auf Plattformen wie kununu oder Glassdoor widerspiegelt. Im Durchschnitt steigen positive Arbeitgeberbewertungen um 1,2 Sterne nach Einführung von Wellbeing-Budgets.
Die Auswirkungen auf die Mitarbeiterzufriedenheit sind ebenso beeindruckend. Der Employee Net Promoter Score, der misst, wie wahrscheinlich Mitarbeitende ihr Unternehmen als Arbeitgeber weiterempfehlen würden, steigt typischerweise um 25 bis 40 Punkte. Ganze 89 Prozent der Mitarbeitenden mit Zugang zu einem Wellbeing-Budget fühlen sich vom Arbeitgeber wertgeschätzt, und die allgemeinen Engagement-Scores verbessern sich um durchschnittlich 32 Prozent.
Die Einführung eines Wellbeing-Budgets erfolgt idealerweise in vier klar strukturierten Phasen. In der ersten Phase, die typischerweise ein bis zwei Wochen in Anspruch nimmt, steht die strategische Planung und Budget-Festlegung im Vordergrund. Zunächst gilt es, die Höhe des Budgets pro Mitarbeiter festzulegen. Dabei sollten Sie einen Blick auf den Markt werfen und recherchieren, was Wettbewerber in Ihrer Branche zahlen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Unternehmensgröße, denn größere Organisationen haben oft mehr Spielraum. Als Einstieg empfehlen wir mindestens 50 Euro pro Monat, was 600 Euro pro Jahr entspricht.
Im nächsten Schritt definieren Sie die erlaubten Kategorien. Hier gibt es grundsätzlich drei Ansätze: Ein sehr liberaler Ansatz erlaubt alles, was das Wohlbefinden fördert, ohne weitere Einschränkungen. Der mittlere Weg arbeitet mit vordefinierten Kategorien, lässt aber innerhalb dieser Flexibilität zu. Ein restriktiver Ansatz beschränkt sich auf ausgewählte Anbieter, was wir allerdings nicht empfehlen würden, da dies die Hauptvorteile der Flexibilität zunichte macht. Parallel dazu sollten Sie unbedingt die steuerlichen Rahmenbedingungen klären. Bis zu 50 Euro pro Monat sind als Sachbezug steuerfrei möglich, Beträge darüber können pauschal versteuert werden oder als Teil des Gehalts behandelt werden. Ein Gespräch mit Ihrem Steuerberater ist hier unverzichtbar.
Die zweite Phase widmet sich der technischen Umsetzung und dauert etwa drei bis vier Wochen. Hier empfehlen wir dringend die Nutzung einer spezialisierten Benefit-Plattform. Diese Lösung bietet zahlreiche Vorteile: Die Verwaltung läuft automatisiert ab, Mitarbeitende erhalten ein übersichtliches Dashboard, HR hat Zugriff auf umfassendes Reporting und Analytics, und das System ist compliance-sicher aufgesetzt. Plattformen wie emplu, Benefits.me oder Belonio sind hier etablierte Anbieter. Die manuelle Verwaltung über Excel-Sheets und Belegeinreichung ist zwar theoretisch möglich, aber nur für sehr kleine Teams mit weniger als 20 Personen praktikabel, da der Verwaltungsaufwand sonst unverhältnismäßig hoch wird.
In der dritten Phase, die weitere ein bis zwei Wochen umfasst, steht die Kommunikation und der Launch im Mittelpunkt. Die interne Kommunikation ist dabei absolut entscheidend für den Erfolg des gesamten Programms. Beginnen Sie etwa zwei Wochen vor dem Launch mit der Ankündigung an alle Mitarbeitenden. Dies sollte sowohl per E-Mail als auch in einer Informations-Session erfolgen, sei es als Townhall-Meeting oder als aufgezeichnetes Video. Parallel dazu bereiten Sie ein umfassendes FAQ-Dokument vor, das die häufigsten Fragen beantwortet.
Der eigentliche Launch sollte mit einem Event gefeiert werden, bei dem Sie eine Live-Demo der Plattform oder des Systems zeigen. Präsentieren Sie konkrete Use-Cases, die zeigen, wie verschiedene Mitarbeitende das Budget nutzen können, und planen Sie ausreichend Zeit für eine Question-and-Answer-Session ein. Als besonderes Highlight können Sie einen ersten Wellbeing-Tag zum Ausprobieren einführen. Stellen Sie zudem umfangreiche Materialien bereit: eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung, Video-Tutorials für alle wichtigen Funktionen, eine Liste mit Beispielen für zulässige Ausgaben und natürlich klare Informationen über den Support-Kontakt.
Die vierte Phase umfasst das fortlaufende Monitoring und die kontinuierliche Optimierung des Programms. Hier gibt es mehrere Kennzahlen, die Sie regelmäßig tracken sollten. Die Nutzungsrate zeigt Ihnen, wie viele Mitarbeitende das Budget tatsächlich verwenden. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person geben Aufschluss darüber, ob das Budget angemessen bemessen ist. Analysieren Sie, welche Kategorien besonders beliebt sind, um zu verstehen, wo die Bedürfnisse Ihrer Belegschaft liegen. Führen Sie regelmäßige Zufriedenheitsumfragen durch und vergleichen Sie die Krankenstandstage vor und nach der Einführung des Programms.
Nehmen Sie sich quartalsweise Zeit für eine gründliche Überprüfung. Welche Benefits werden am meisten genutzt und warum? Gibt es ungenutzte Budgets, und falls ja, was sind die Gründe dafür? Holen Sie aktiv Feedback von Ihren Mitarbeitenden ein und scheuen Sie sich nicht, basierend auf diesen Erkenntnissen Anpassungen vorzunehmen. Ein Wellbeing-Budget-Programm sollte kontinuierlich wachsen und sich an die sich verändernden Bedürfnisse Ihrer Belegschaft anpassen.
Einer der häufigsten Fehler bei der Implementierung von Wellbeing-Budgets sind zu komplizierte Regelungen. Manche Unternehmen erstellen 50-seitige Richtlinien mit komplexen Freigabeprozessen, die mehr abschrecken als helfen. Die Lösung liegt in der Einfachheit: Beschränken Sie sich auf maximal drei bis fünf Kategorien und formulieren Sie einfache, klare Regeln. Eine gute Praxis ist es, den Grundsatz zu verfolgen: "Nutze dein Budget für alles, was dein Wohlbefinden fördert. Im Zweifelsfall: frag einfach." Diese Klarheit und Offenheit macht das Programm zugänglich und reduziert Hemmschwellen.
Ein zweiter kritischer Fehler ist zu wenig Kommunikation. Es kommt tatsächlich vor, dass Mitarbeitende gar nicht wissen, dass es das Budget gibt oder wie es funktioniert. Die Lösung liegt in regelmäßigen Erinnerungen und aktiver Kommunikation. Teilen Sie Success Stories, wie Kolleginnen und Kollegen das Budget nutzen, und gamifizieren Sie die Nutzung, wo es sinnvoll ist. Ein monatlicher Wellbeing-Newsletter mit konkreten Ideen zur Budget-Nutzung hat sich in vielen Unternehmen bewährt und hält das Thema präsent.
Der dritte Fehler betrifft die "Use it or lose it"-Mentalität ohne jegliche Ausnahmen. Wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, ihr Budget bis Jahresende unbedingt ausgeben zu müssen, entsteht unnötiger Druck und das Budget wird möglicherweise für weniger sinnvolle Dinge ausgegeben. Eine bessere Lösung ist es, eine teilweise Übertragbarkeit ins nächste Jahr zu ermöglichen. Eine Empfehlung lautet, dass 50 Prozent des ungenutzten Budgets ins Folgejahr übertragen werden können. Dies nimmt den Druck und ermöglicht es Mitarbeitenden, das Budget wirklich für ihre tatsächlichen Bedürfnisse einzusetzen.
Viele Unternehmen begehen auch den Fehler, keine Erfolgsmessung durchzuführen. Ohne Daten gibt es keine Basis für Optimierung, und das Potenzial des Programms wird verschenkt. Die Lösung ist einfach: Definieren Sie von Anfang an klare KPIs und messen Sie diese regelmäßig. Zu den wichtigsten Metriken gehören die Nutzungsrate, die Mitarbeiterzufriedenheit, die Entwicklung der Krankenstandstage und die Fluktuation. Diese Daten liefern nicht nur die Grundlage für Verbesserungen, sondern auch wichtige Argumente gegenüber dem Management.
Ein letzter häufiger Fehler sind zu restriktive Kategorien. Wenn beispielsweise nur Fitness und Physiotherapie erlaubt sind, wird der wichtige Bereich der mentalen Gesundheit komplett ausgeklammert. Die Lösung liegt darin, ein breites Spektrum abzudecken und sowohl mentale als auch physische Gesundheit gleichwertig zu behandeln. Ein ganzheitlicher Ansatz, der verschiedene Dimensionen des Wohlbefindens berücksichtigt, führt zu den besten Ergebnissen.
Die Arbeitswelt entwickelt sich kontinuierlich weiter, und Wellbeing-Budgets sind Teil mehrerer größerer Trends, die die Zukunft der Mitarbeiterführung prägen werden. Der erste dieser Trends ist die Entwicklung von isolierten Benefits hin zu Total Rewards. Unternehmen denken zunehmend ganzheitlich und verstehen, dass das Wertversprechen an Mitarbeitende aus mehreren Komponenten besteht: Gehalt, Benefits, Wellbeing, Entwicklungsmöglichkeiten und Unternehmenskultur bilden zusammen das Gesamtpaket. Wellbeing-Budgets sind dabei ein wichtiger Teil dieses umfassenden Wertangebots, aber nicht isoliert zu betrachten.
Der zweite bedeutende Trend ist die datengetriebene Personalisierung. Die nächste Stufe der Entwicklung wird KI-gestützte Empfehlungen umfassen, die auf dem individuellen Nutzungsverhalten basieren. Predictive Analytics könnten dabei helfen, Burnout-Prävention proaktiv zu gestalten, indem Warnsignale frühzeitig erkannt werden. Personalisierte Wellbeing-Pläne, die auf die spezifischen Bedürfnisse einzelner Mitarbeitender zugeschnitten sind, werden zunehmend zur Realität.
Ein dritter wichtiger Trend ist die Integration von Wellbeing in umfassende Employee Experience Plattformen. Wellbeing wird nicht mehr isoliert betrachtet, sondern ist integraler Bestandteil der gesamten Mitarbeitererfahrung. Dies beginnt bereits beim Onboarding, setzt sich im Performance Management fort, ist Teil von Learning und Development und reicht bis zum Offboarding. Diese ganzheitliche Integration sorgt dafür, dass Wohlbefinden kontinuierlich mitgedacht wird, nicht nur als separates Programm.
Der vierte Trend betrifft die Etablierung globaler Wellbeing-Standards. Die WHO entwickelt Guidelines für Workplace Wellbeing, ISO-Zertifizierungen für Gesundheitsmanagement werden immer relevanter, und ESG-Reporting umfasst zunehmend auch Employee Wellbeing. Unternehmen werden in Zukunft nicht nur über ihre Umweltbilanz Rechenschaft ablegen müssen, sondern auch darüber, wie sie für das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden sorgen.
Bevor Sie mit der Implementierung eines Wellbeing-Budgets beginnen, sollten Sie prüfen, ob Ihr Unternehmen die notwendigen Voraussetzungen erfüllt. Auf strategischer Ebene ist es wichtig, dass das Leadership vom Business Case überzeugt ist und das notwendige Budget freigegeben wurde. Wellbeing sollte zudem Teil der übergeordneten Unternehmensstrategie sein, nicht nur ein isoliertes HR-Projekt.
Organisatorisch muss Ihr HR-Team über die Kapazität für die Implementierung verfügen. Klare Verantwortlichkeiten sollten definiert sein, und eine durchdachte Kommunikationsstrategie sollte bereits stehen, bevor Sie mit dem Rollout beginnen. Auf technischer Ebene sollten Sie bereits ein Tool oder eine Plattform ausgewählt haben, die IT-Infrastruktur muss kompatibel sein, und alle DSGVO-Anforderungen sollten im Vorfeld geklärt worden sein.
Die finanziellen Voraussetzungen umfassen die Festlegung des Budgets pro Mitarbeiter, die Klärung der steuerlichen Gestaltung mit einem Steuerberater und die Definition der Kostenstellenzuordnung. Nicht zu unterschätzen ist auch die kulturelle Bereitschaft: Ihre Mitarbeitenden sollten offen für neue Benefits sein, eine Vertrauenskultur sollte im Unternehmen vorhanden sein, und etablierte Feedback-Mechanismen erleichtern die kontinuierliche Verbesserung des Programms. Wenn Sie mindestens zwölf von fünfzehn dieser Punkte positiv beantworten können, sind Sie bereit für den Launch.
Wellbeing-Budgets sind mehr als nur ein moderner Benefit-Trend. Sie repräsentieren einen fundamentalen Wandel in der Art, wie Unternehmen Mitarbeitende unterstützen:
Weg von: Paternalistischen Vorgaben ("Wir wissen, was gut für euch ist") Hin zu: Autonomie und Selbstbestimmung ("Ihr wisst am besten, was euch hilft")
Die Zahlen sprechen für sich:
In einer Zeit, in der mentale Gesundheit zur größten Herausforderung am Arbeitsplatz wird, sind flexible Wellbeing-Budgets keine Nice-to-Have-Luxus-Benefits mehr – sie sind eine strategische Notwendigkeit.
Unternehmen, die jetzt in individualisierbare Gesundheitsförderung investieren, verschaffen sich einen entscheidenden Vorteil im War for Talent und bauen resilientere, gesündere und produktivere Teams auf.
Die Frage ist nicht mehr "ob", sondern nur noch "wann" und "wie" Sie Wellbeing-Budgets einführen.
Die Implementierung eines Wellbeing-Budgets lässt sich in drei zeitliche Phasen gliedern, die aufeinander aufbauen und jeweils konkrete Meilensteine umfassen. In den nächsten zwei Wochen sollten Sie kurzfristig drei wichtige Schritte angehen. Erstellen Sie zunächst einen fundierten Business Case, der die Zahlen und Argumente aus diesem Artikel nutzt. Dieser Business Case dient als Grundlage, um die relevanten Stakeholder zu überzeugen. Bereiten Sie dafür eine überzeugende Präsentation für die Geschäftsführung oder den Vorstand vor. Sobald diese überzeugt sind, können Sie das Budget freigeben lassen. Falls es zunächst Bedenken gibt, kann der Start mit einer Pilotphase ein guter Kompromiss sein.
In den folgenden vier bis acht Wochen stehen mittelfristige Aufgaben an. Beginnen Sie mit der Auswahl des richtigen Tools, indem Sie Demos mit verschiedenen Anbietern vereinbaren und Angebote einholen. Parallel dazu sollten Sie die Richtlinien für Ihr Wellbeing-Budget definieren, wobei Sie unbedingt auf Einfachheit achten sollten. Komplexe Regelwerke schrecken ab und reduzieren die Nutzung. Entwickeln Sie gleichzeitig eine durchdachte Kommunikationsstrategie: Wie werden Sie das Programm intern verkaufen und welche Botschaften sind wichtig?
Langfristig, also in den nächsten drei bis sechs Monaten, geht es um die konkrete Umsetzung und kontinuierliche Verbesserung. Starten Sie mit einer Pilotphase, in der Sie das Programm mit 50 bis 100 Mitarbeitenden testen. Holen Sie aktiv Feedback ein und optimieren Sie das Programm iterativ basierend auf den Erkenntnissen. Nach erfolgreicher Pilotphase können Sie den vollständigen Rollout auf die gesamte Organisation ausweiten. Vergessen Sie dabei nicht, Erfolge zu messen und sichtbar zu machen. Diese Erfolgsgeschichten sind nicht nur motivierend für die Teilnehmenden, sondern auch wichtig für die interne Kommunikation und die Rechtfertigung der Investition.